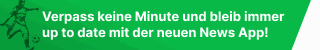Saison 1968/69: FC Bayern außer Konkurrenz (Teil I)

Der deutsche Fußball genoss weltweit hohes Ansehen. Die Einladungen an Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath und Willi Schulz, an dem Jubiläumsspiel einer Weltauswahl gegen Brasilien teilzunehmen (die Südamerikaner gewannen 2:1, Schulz war bester Spieler der Weltauswahl und schaltete Pelé fast komplett aus) spiegelte das wider. Doch der Fußballalltag der deutschen Kicker war von grauen Schatten begleitet: Die Bundesliga hatte an Zugkraft eingebüßt; die Besucherzahlen früherer Jahre wurden nicht mehr erreicht. Zahlreiche Spielverlegungen, den katastrophalen Witterungsbedingungen in den Wintermonaten geschuldet, verzerrten den Spielbetrieb und verstärkten die Abkehr des Publikums noch. Zwei bayrische Klubs rahmten nach Saisonabpfiff das 16er Feld ein: Ganz oben der aufstrebende FC Bayern München, ganz unten der abgestürzte Titelverteidiger aus Nürnberg.
Die Aufsteiger
Eine einzige Niederlage kassierten die Offenbacher Kickers in den Aufstiegsrundenspielen - das 2:3 bei Arminia Hannover in der letzten Partie. Da zu diesem Zeitpunkt der erstmalige Sprung in die Bundesliga jedoch schon gesichert war, betrachteten die Hessen diesen Ausrutscher als leicht zu verkraftenden Schönheitsfehler. Übungsleiter Kurt Schreiner konnte allerdings selbst dieser Erfolg nicht zur Fortsetzung seiner Trainerkarriere animieren. "Ich bin beruflich zu sehr in Anspruch genommen. Der Verein wird einen neuen Mann engagieren müssen." Das tat der Verein dann auch, und verpflichtete einen Mann, unter dem Schreiner noch als Spieler aufgelaufen war: Paul Oßwald. Der einzige Klub aus Gruppe 1, der noch auf Augenhöhe mit Offenbach mithalten konnte, war Bayer Leverkusen. Die Kickers errangen jedoch ein Remis beim Werksklub und behielten daheim mit 2:1 die Oberhand. Das waren die entscheidenden zwei Zähler, die Offenbach am Ende besser war. Die anderen Gruppengegner, der TuS Neuendorf, Tennis Borussia Berlin und Arminia Hannover landeten abgeschlagen auf den Plätzen.
Drei Jahre hatte Hertha BSC das Zugpferd in der Stadtliga Berlin gespielt, das in den nachfolgenden Aufstiegsrunden zur Bundesliga dann jeweils strauchelte. Im Mai und Juni 1968 war das anders: Die Hertha überstand die Qualifikation erfolgreich und kehrte auf die große Fußballbühne zurück. Von enormer Bedeutung war bereits das erste Spiel in der Gruppe 2, das die Berliner nach Essen führte. Die Rot-Weißen waren Herthas ärgster Rivale und wähnten sich nach ihrer 2:0-Führung bereits auf der sicheren Seite, als ein Doppelschlag der Berliner (66., Sangulin und 71., Ipta) noch zur 2:2-Punkteteilung führte. "Zwei solche Gegentore? Das ist doch unmöglich! Unsere Abwehrspieler waren wohl sanft entschlummert", erregte sich RWE-Trainer Erich Ribbeck, der mit Essen den Aufstieg zwar verpasste, aber dennoch in die Bundesliga aufsteigen sollte - als neuer Coach der Frankfurter Eintracht. Naturgemäß war Herthas Übungsleiter Helmut Kronsbein etwas besser gelaunt, aber auch nicht ganz zufrieden: "In der Abwehr sah ich einiges, was ich lieber nicht gesehen hätte", grantelte er. Der Anblick der Abschlusstabelle dürfte ihm indes vorbehaltlos gefallen haben. Sie dokumentierte, dass die Berliner ihr Ziel erreicht hatten, während die Konkurrenten Rot-Weiß Essen, der SV Alsenborn, Göttingen 05 und der FC Bayern Hof sich auf eine weitere Regionalligasaison einstellen konnten.

Kontroverse Diskussionen
Nur 230.000 Zuschauer strömten am ersten Spieltag in die Stadien, was einem durchschnittlichen Besuch von 25.500 Fans entsprach. Enttäuschend, war doch die doppelte Auslastung von 460.000 Besuchern möglich. Zudem waren es im Vorjahr durchschnittlich noch 35.900 Menschen, die den Saisonstart vor Ort verfolgen wollten. Das gesunkene Zuschauerinteresse sollte den Vereinen noch die gesamte Spielzeit über quer im Magen liegen. Erschwerend kam hinzu, dass der Wettergott dem Fußballgott schwer in die Parade grätschte. Bereits im August (!) mussten Spiele, in Bremen und Dortmund, verlegt werden, da es wie aus Kübeln geschüttet hatte und die neu entstandenen Seenplatten unbespielbar waren. Auch die tropischen Temperaturen zu Beginn der Saison schreckten so manchen Stadiongänger ab. Wahrhaft katastrophal wurde die Situation allerdings erst während der Wintermonate, als aufgrund der Witterungsbedingungen serienweise Begegnungen abgesagt werden mussten. Der Spielplan geriet völlig aus den Fugen, die Termine für die Nachholspiele wurden knapp und die Tabelle konnte niemanden befriedigen - die vielen nachzuholenden Partien machten einen verbindlichen Blick auf die tatsächliche Platzierung unmöglich.
So wurde der Ruf nach einer Winterpause lauter; zudem waren weitere Maßnahmen gefragt, die das Publikum verstärkt in die Arenen zurück locken sollten. Bayern-Star Franz Beckenbauers Appell nach mehr Komfort fand viele Fürsprecher:"Die Menschen unserer Zeit sind bequem. Sie wollen nicht zwei Stunden und mehr eingepfercht stehen. Deshalb müssen alle Stadien Sitzplätze haben." Gladbach-Trainer Hennes Weisweiler hatte einen anderen Ansatz der Kritik: "Die Bundesliga ist einfach schlechter geworden. Es wird nicht gut genug gespielt. Alles spielt auf Abwehr. Am liebsten mit acht Mann." Meistertrainer Max Merkel schlug in dieselbe Kerbe: "Es muss einfach wieder besser Fußball gespielt werden." Angesichts der Einnahmerückgänge wandte sich eine Initiative des FC Schalke, unter Federführung des im November 1968 neu verpflichteten Übungsleiters Rudi Gutendorf, mit einem Acht-Punkte-Maßnahmenkatalog an den DFB. U.a. wurden folgende Forderungen formuliert: Einführung einer Winterpause, weniger Einschränkungen bei Transfers, mehr Geld für die Vereine aus den Toto-Einnahmen sowie den Fernsehgeldern und, fast schon revolutionär - Selbstbestimmung der Bundesligaklubs in eigenen Belangen, ohne dass dem DFB das letzte Wort bliebe.
Mit der Neuerung, dass nunmehr zwei Spieler pro Team während der 90 Minuten ausgewechselt werden durften, hatten sich selbst Ende November 1968 noch nicht alle Beteiligten angefreundet. Kurioserweise sprach sich der Großteil der Befragten gegen diese Praxis aus: "Welcher Spieler ist schon so nervenstark, die ‚Raus´-Rufe des Publikums, mögen sie ihm oder einem Nebenmann gelten, zu verkraften?", sorgte sich Nürnbergs Stürmer Heinz Strehl. "Es werden Halbstunden-Spieler aufgezogen", befürchtete Frankfurts Keeper Hans Tilkowski. "Es ist kein Zufall, dass jene Mannschaften am meisten wechselten, die am schlechtesten stehen", schob er hinterher. "Wenn alle elf aufeinander angewiesen sind und keiner während des Spiels abtreten kann, sind sie eine viel stärkere Gemeinschaft", glaubte Offenbachs Kapitän Hermann Nuber. "Meist war der neu hereingekommene Spieler schwächer als der Ausgewechselte", stand Georg Knöpfle, der technische Direktor des HSV, dem Wechseln ebenfalls eher skeptisch gegenüber. "Das große Plus des Spielertauschs liegt ohne Zweifel darin, dass verletzte Spieler ausgetauscht werden können. Ich erinnere mich an kein Bundesligaspiel, das eine Mannschaft mit neun Spielern beenden musste", stellte Franz Beckenbauer fest; und dem Argument war nicht beizukommen.
André Schulin
Des isch keine Missachtung, des isch meine Dummheit.
— Freiburg-Coach Christian Streich, der den Namen des Stuttgarter Stürmers Hamadi Al Ghaddioui nicht aussprechen konnte.