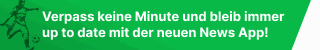Saison 1968/69: FC Bayern außer Konkurrenz (Teil II)

Schiedsrichter haben es oftmals nicht leicht: Diskussionen um ihre Pfiffe, Konkurrenz aus dem Publikum und manchmal auch Spieler, die ihren Namen partout nicht preisgeben wollen ...
Schiris in Nöten
Schiedsrichter Hillebrand hatte beim Spiel 1860 München gegen Werder Bremen einen Feind im Publikum - einen Unbekannten, der mit einer Trillerpfeife die Spieler irritierte. So kam zum Beispiel Werders Diethelm Ferner unbehelligt zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer, da die Münchener Abwehrspieler nach einem vermeintlichen Abseitspfiff das Spielen einstellten und Ferner freie Bahn hatte. Hillebrand hatte jedoch nicht gepfiffen. Erbost ließ der Unparteiische über den Stadionsprecher verkünden, er verbitte sich Pfiffe aus dem Publikum - was die Menge natürlich mit einem Pfeif-Inferno quittierte. Edgar Deuschel, der Referee des Spiels Hamburger SV gegen 1860 München leistete sich, bevor er ihn vom Platz stellte, ein kurzes Verbalscharmützel mit HSV-Linksaußen Charly Dörfel, der sich nach einem Münchener Foulspiel erregte. "Wie heißen Sie?", rief Deuschel daraufhin dem Hamburger zu - die Vorschrift befolgend, einen Spieler, den er verwarnen will, nach dem Namen zu fragen. "Meier", hallte es von Dörfel zurück. Deuschel wiederholte seine Anrede: "Wie heißen Sie?" "Meier", lautete die Antwort unverändert. Deuschels humorloses "Runter, Herr Dörfel" beendete den Dialog und führte nebenbei die Vorschrift ad absurdum. Nicht ganz so flott war die Malaise zwischen Schiedsrichter Walter Horstmann und den "Löwen" Petar Radenkovic und Bernd Patzke abgehandelt. Beim Gastspiel in Dortmund hatte sich Patzke über einen strittigen Elfmeterpfiff des Schiris mit den Worten ausgelassen: "Der ist ja besoffen." Sechzigs Kapitän Radenkovic nahm die Aussage beim Wort und beschwatzte den verdutzten Schiri - der nach eigenen Angaben vor dem Spiel lediglich einen Underberg zu sich genommen hatte - sich einem Alkoholtest zu unterziehen. Das dicke Ende folgte in Gestalt von DFB-Chefankläger Hans Kindermann, der sich über das Handeln von "König" Radi empörte ("Was der getan hat, war das Unverschämteste, was mir bisher untergekommen ist") und die beiden Münchener Spieler auf die Anklagebank zerrte. Patzke kam mit einer Geldstrafe davon, während Radenkovic drei Spieltage gesperrt wurde.
Schicksalsschläge
Neben diesen eher erheiternden Episoden blieb die Bundesliga aber keineswegs von herben Schicksalsschlägen verschont, wie besonders zwei Ereignisse verdeutlichten. "Hans Merkle, Trainer des 1. FC Köln, weinte nach dem Schlusspfiff bittere Tränen", berichtete im Februar das Fachblatt "Kicker Sportmagazin". Die Gefühlsregung des Übungsleiters war auf die Szene aus der 49. Minute des Spiels Köln gegen Kaiserslautern zurückzuführen, als Kölns Keeper Milutin Soskic mit dem Lauterer Hasebrink zusammenprallte. Die Geißbockelf stand zu diesem Zeitpunkt sportlich mit dem Rücken zur Wand. Deshalb hatte man Soskic, der gerade die Folgen eines Beinbruchs auskuriert hatte, zu einer schnellen Rückkehr bewegt. Im zweiten BL-Spiel nach seinem Comeback, beim Zweikampf mit Hasebrink, brach das Bein erneut. Das war quasi gleichbedeutend mit dem Karriereende des Jugoslawen, der lediglich in der Saison 1970/71 noch zu vier Einsätzen für Köln kam. Erschütternder noch war der Unfalltod des Braunschweiger Abwehrspielers Jürgen Moll, der gemeinsam mit seiner Frau an den Folgen eines Autounfalls verstarb. Das junge Paar hinterließ zwei Töchter, zu deren Gunsten sich Molls Bundesligakollegen zu einem Benefizspiel - Eintracht Braunschweig gegen eine Spielerauswahl von 16 BL-Klubs - zusammenfanden. Diese Geste der Verbundenheit stand der Liga gut zu Gesicht. Auch das aufmerksame Eingreifen der "Löwen"-Akteure Manfred Wagner und Zeljko Perusic im November `68 sorgte für positive Schlagzeilen und Sympathien in Zeiten, da das Publikum dem Bundesligaalltag weniger Zuwendung entgegen brachte. Die beiden Sechziger retteten der zweieinhalbjährigen Sonja Schwaiger das Leben, die im Deiniger Weiher eingebrochen war und im Eiswasser zu ertrinken drohte.
Bedrohte Einnahmen
Den Bundesligaprofis stand das Wasser - finanziell betrachtet - zwar noch nicht bis zur Halskrause, aber etliche Vereine spekulierten ob der durch geschrumpfte Zuschauerzahlen bedingten Einnahmeverluste schon mit Gehaltskürzungen. Da war so manch einer froh, neben dem Fußball noch ein zweites Standbein zu haben. Dortmunds Stopper Wolfgang Paul beispielsweise hatte als ausgebildeter Optikermeister eine sichere Existenzgrundlage in der Hinterhand und Frankfurts Schlussmann Peter Kunter büffelte parallel zum Spielbetrieb an seiner Doktorarbeit (Zahnmedizin). Die meisten Spieler setzten jedoch darauf - insofern sie es nicht schon in den Vorjahren getan hatten - sich als Kleinunternehmer Rücklagen zu schaffen. Braunschweigs Flügelflitzer Klaus Gerwien hielt mit der Eröffnung einer Expressreinigung Einzug in diese Gilde, Duisburgs Torwart Manfred Manglitz führte nebenbei eine Tankstelle und eine Buchbinderei. Sechzigs Schlussmann Petar Radenkovic vermarktete seine Popularität auf vielfältige Weise, und für "Radi-Torwarthandschuhe" lag die Affinität ja auch auf der Hand. Aber für "Radi-Slibowitz?" Und dann vom Schiri einen Alkoholtest fordern ...
Von den o.a. Gehaltskürzungen waren jedoch nicht ausschließlich nur die Spieler bedroht. Das "Kicker Sportmagazin" berichtete im Februar, dass Club-Trainer Max Merkel die Streichung eines Drittels seines Einkommens (von 18.500 Mark auf 12.000 Mark) zu verkraften hatte.
André Schulin
Bundesliga Chronik
Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
— Sepp Maier, FC Bayern, zur ,,ruhigen" Meisterschaft 1972 am 30. Spieltag.