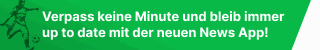Saison 1971/72: FC Bayern bändigt Königsblau (Teil III)

Uwe Seeler verabschiedete sich mit einer starbesetzten Gala und putzmunter vom Leistungssport, derweil Otto Rehhagels Karriere durch eine Verletzung schmerzhaft vorzeitig beendet wurde. Der ehrgeizige Lauterer Abwehrspieler nahm jedoch umgehend neue Ziele ins Visier. Die Bremer scheiterten mit ihrem Versuch, den großen Erfolg einzukaufen …
Die sichere Mitte
Mit Eintracht Frankfurt begann das Mittelfeld. Der Tiefschlag aus der vergangenen Saison (Rang 15) war abgehakt: Die Hessen hatten lediglich im ersten Saisondrittel Kontakt zu fragwürdigen Tabellenregionen, etablierten sich danach jedoch - weil die neuen Stürmer Conca (7 Treffer) und Parits (12) allmählich auftauten - als Speerspitze des Mittelfeldes. Die größte Torgefahr seitens der Hessen verbreitete jedoch Bernd Nickel (13). „Nickel schießt verteufelte Bälle“, urteilte HSV-Trainer Klaus-Dieter Ochs über den „Doktor Hammer“ genannten Nickel. Dass Hertha BSC schlussendlich als Sechster die Ziellinie überquerte, war zweifellos als Erfolg zu werten, auch wenn man im Vorjahr noch Dritter war. Die Berliner fanden sich über weite Strecken der Saison im Visier der DFB-Ermittlungen im Bundesligaskandal wieder. Schlagzeilen wie „Kassierten alle Herthaspieler?“ (Sportmagazin Kicker, September 1971) begleiteten den sportlichen Werdegang. Tatsächlich wurden während der laufenden Saison mehrere Profis suspendiert; der Verlust des spielstarken Ungarn Zoltan Varga traf die Berliner hart. Kaiserslauterns „Rote Teufel“ schenkten ihrem Anhang eine bemerkenswert stabile Spielzeit ohne Abstiegsnot (Platz 7). Wermutstropfen war das vorzeitige Karriereende des 33-jährigen Abwehrrecken Otto Rehhagel, der sich im Spiel gegen den MSV Duisburg eine schwere Verletzung zuzog (Absprengung eines Knorpels im Oberschenkel). Der Fußballfanatiker Rehhagel („Zugegeben, ich bin etwas krankhaft ehrgeizig“) erwarb umgehend in der Sporthochschule Köln das Trainerdiplom. „Zu den Spielern, die uns verlassen haben, zählten wirklich gute Spieler“, trat VfB-Trainer Branko Zebec eine Woche vor dem Bundesligastart die Bremse, um der Euphorie im Umfeld Herr zu werden. Die Neuverpflichtungen von Ettmayer, Coordes und Köppel hatten dem VfB Stuttgart in der öffentlichen Wahrnehmung zum Status eines Geheimfavoriten verholfen. Aber Zebec’ Skepsis war berechtigt. Der personell stark umgebrochene VfB Stuttgart schien nur anfangs in der Lage, seiner Einordnung als Geheimtipp gerecht werden zu können. Wie im Vorjahr pendelte man sich, wenn auch leicht verbessert, im gesicherten Mittelfeld ein (Rang 8). Aufsteiger VfL Bochum schlug sich wacker und landete in der oberen Tabellenhälfte (Platz 9), was nicht unerheblich auf den glanzvollen Bundesligaeinstieg des Torjägers Hans Walitza (22 Treffer) zurückzuführen war. Trainer Hermann Eppenhoff beklagte, dass er aufgrund der fehlenden Planungssicherheit seinen Kader erst nach Beendigung der Aufstiegsrunde verstärken konnte. „Nach unserem Aufstieg war alles weg“, stellte Eppenhoff ernüchtert fest, dass der Spielermarkt leergefegt war. Lediglich Ex-BVB-Spieler Reinhold Wosab konnte als echte Sofortverstärkung verpflichtet werden. Dieses Manko hinderte die Bochumer allerdings nicht daran, sich noch vor dem Hamburger SV (Platz 10) einzureihen. Die Männer aus der Elbmetropole hatten sich hochrangig verstärken können; hausgemachte Probleme zerstörten jedoch die Erfolgschancen. „Bubi Hönig, der hinter mir spielt, scheint mich ja überhaupt nicht zu kennen und Klaus Zaczyk spielt doch nur für sich …“, schimpfte der vom 1. FC Nürnberg zum HSV gekommene „Schorsch“ Volkert wie ein Rohrspatz. Der neue HSV-Linksaußen „verhungerte“ in den ersten Spielen förmlich, während sein Vorgänger, „Charly“ Dörfel, von Trainer Klaus Ochs aussortiert wurde. „Volkert ist mein Mann für Linksaußen. Für Dörfel ist kein Platz mehr!“, hatte Ochs sich vor der Saison festgelegt; Dörfel kam noch auf lediglich vier Einsätze. Der dem Linksaußen-Klischee überaus kompatible Dörfel beantwortete seine Ausbootung mit Eskapaden, die in der HSV-Führung zur Überlegung führten, den Dribbler mitten in der Saison rauszuschmeißen. „Es kann die Kraft eines Trainers übersteigen, mit einem Gert Dörfel fertig werden zu müssen“, stöhnte HSV-Vizepräsident Baumann. Einmal noch durfte „Charly“ im HSV-Trikot ran: als sein langjähriger Weggefährte, Deutschlands Fußballidol Uwe Seeler, im Mai 1972 sein Abschiedsspiel gab. Internationale Könner wie Eusebio, Bobby Charlton, Gordon Banks und Gianni Rivera nahmen an der Gala im ausverkauften Volksparkstadion teil.
Gebranntes Kind scheut das Feuer: Werder-Geschäftsführer Hans Wolff dürfte der Sinn jener Weisheit durch den Kopf geschossen sein, als er zwei Spieltage vor Saisonende einen Ausblick auf die nächste Spielzeit ankündigte: „Diesmal fangen wir nicht mit Pauken und Trompeten an“, versprach er. „Wir haben viele negative Briefe erhalten, ich habe sie alle einzeln beantwortet.“ Was war passiert? Nun, der Bremer Versuch, sich der sportlichen Mittelmäßigkeit mittels eines finanziellen Kraftaktes zu entledigen, war kläglich gescheitert. Voller Stolz hatte man vor dem Saisonstart in der Bremer Stadthalle eine Show-Veranstaltung inszeniert, in deren Mittelpunkt die Vorstellung die teuren Starzugänge Dietrich, Laumen und Neuberger stand. Schnell war der Begriff von Bremens „Millionenelf“ geprägt, die eine Rückkehr in die nationale Spitze garantieren sollte. Der Stadtstaat Bremen war in das Projekt involviert, deshalb tauschte man die traditionell grün-weiße Kluft gegen das Rot-Weiß der Bremer „Speckflagge“ ein und platzierte den Bremer Schlüssel als Wappen auf dem Trikot. Das Projekt floppte, nach 34 Spieltagen sprang der 11. Rang heraus - eine noch schlechtere Platzierung als im Jahr zuvor. Dem Mittelmaß entkamen die Bremer also nicht, aber sie durften für sich in Anspruch nehmen, mit Sepp Piontek als erster Bundesliga-Verein einen eigenen Lizenzspieler zum Trainer gemacht zu haben. Eintracht Braunschweig (Rang 12) enttäuschte herb. Vom Biss und Leistungsvermögen der vorherigen Saison, die man als Vierter abschloss, waren Otto Kneflers Mannen um Längen entfernt. Das Generalproblem der Niedersachsen war bekannt. „Ein Lothar Ulsaß in der Form der vergangenen Saison ist für uns zum derzeitigen Moment überhaupt nicht zu ersetzen“, erkannte Knefler bereits in der Saisonvorbereitung. Den Verlust des aufgrund seiner Verwicklung in den Bundesligaskandal gesperrten Ulsaß konnte Braunschweig nicht kompensieren. Fortuna Düsseldorfs Kapitän Fred Hesse, der schon beim ersten Bundesligaauftritt der Fortuna (1966/67) an Bord war, wünschte sich: „Wir wollen lediglich in der Bundesliga drin bleiben“. Das gelang dem Aufsteiger (Rang 13), ohne auch nur einen Spieltag einen Abstiegsrang einzunehmen. Der MSV Duisburg (Platz 14) legte einen ähnlichen Saisonverlauf hin wie Westkonkurrent Düsseldorf: An die vorderen Regionen der Tabelle kam man nicht heran, in ernsthafte Abstiegsnöte aber auch nicht. Das Highlight der Saison war der 3:0-Sieg gegen den FC Bayern am 29. Spieltag. Duisburgs hoch talentiertes Eigengewächs Ronald Worm (DFB-Trainer Herbert Widmayer: „Aus Ronnie Worm will ich den deutschen Rekordnationalstürmer machen“), der in der deutschen Jugendnationalmannschaft brillierte, entschied das Spiel mit zwei Treffern.
Der rote Bereich
Rot-Weiß Oberhausen, Hannover 96, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld kristallisierten sich schon frühzeitig als die meistgefährdeten Klubs der Liga heraus. Arminias Zwangsabstieg wurde bereits erwähnt. Im Frühjahr 1972 versuchten die Bielefelder, durch eine Fusion mit der DJK Gütersloh einen Neustart hinzulegen, was jedoch scheitete: „Völlig lose Gespräche sind zwar geführt worden, ich bezeichne sie aber als Utopie“, berichtete Güterslohs Vorsitzender Dr. August Pötter. Oberhausen und Hannover brauchten nach dem 32. Spieltag weder eine Neukonstituierung ihrer Vereine zu erwägen, noch einen drohenden Abstieg zu fürchten: Die 0:2-Auswärtsniederlage in Stuttgart stempelte den BVB unweigerlich zum zweiten Absteiger. Dortmunds Keeper Jürgen Rynio wurde das zweifelhafte Vergnügen zuteil, bereits mit dem dritten Klub (nach Karlsruhe und Nürnberg) aus der Bundesliga abgestiegen zu sein. Sein Namensschild an der Haustür hatte Rynio („Ich bin doch nur belästigt worden“) schon Wochen vor dem endgültigen Aus entfernt. Das Heimspiel des 20. Spieltages, gegen Köln, musste wegen eines Bombenalarms verlegt werden. Glücklicherweise erwiesen sich die Hinweise auf einen Weltkriegs-“Blindgänger” im Stadion als falsch. Eine Bombe, in Gestalt des unverhofften Abstiegs, zündete dann am Saisonende.
André Schulin
Bundesliga Chronik
Ich weiß, das will kein BVB-Fan hören: Aber ich fürchte, Schalke könnte echt erfolgreich sein.
— Jürgen Klopp